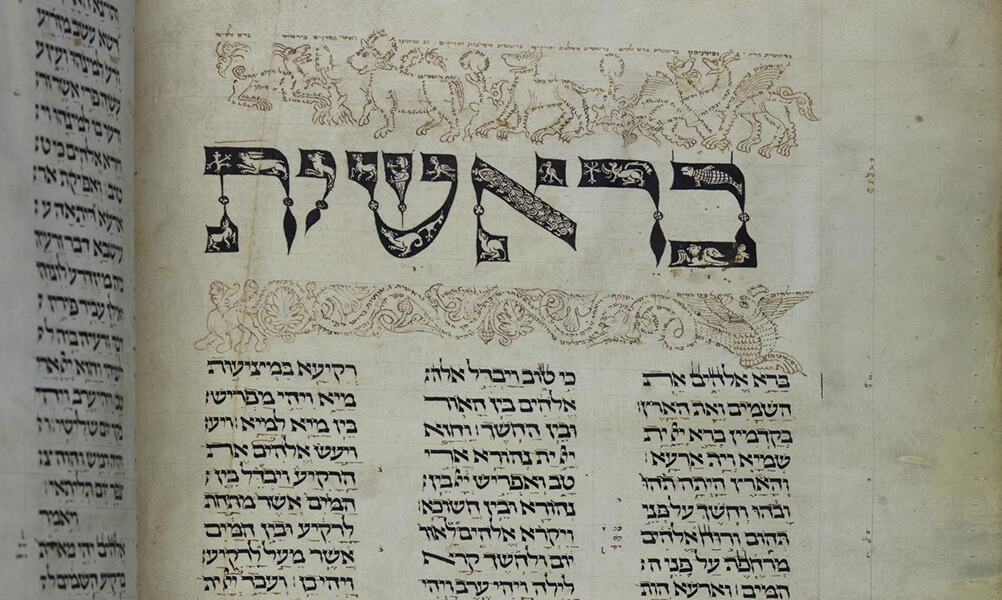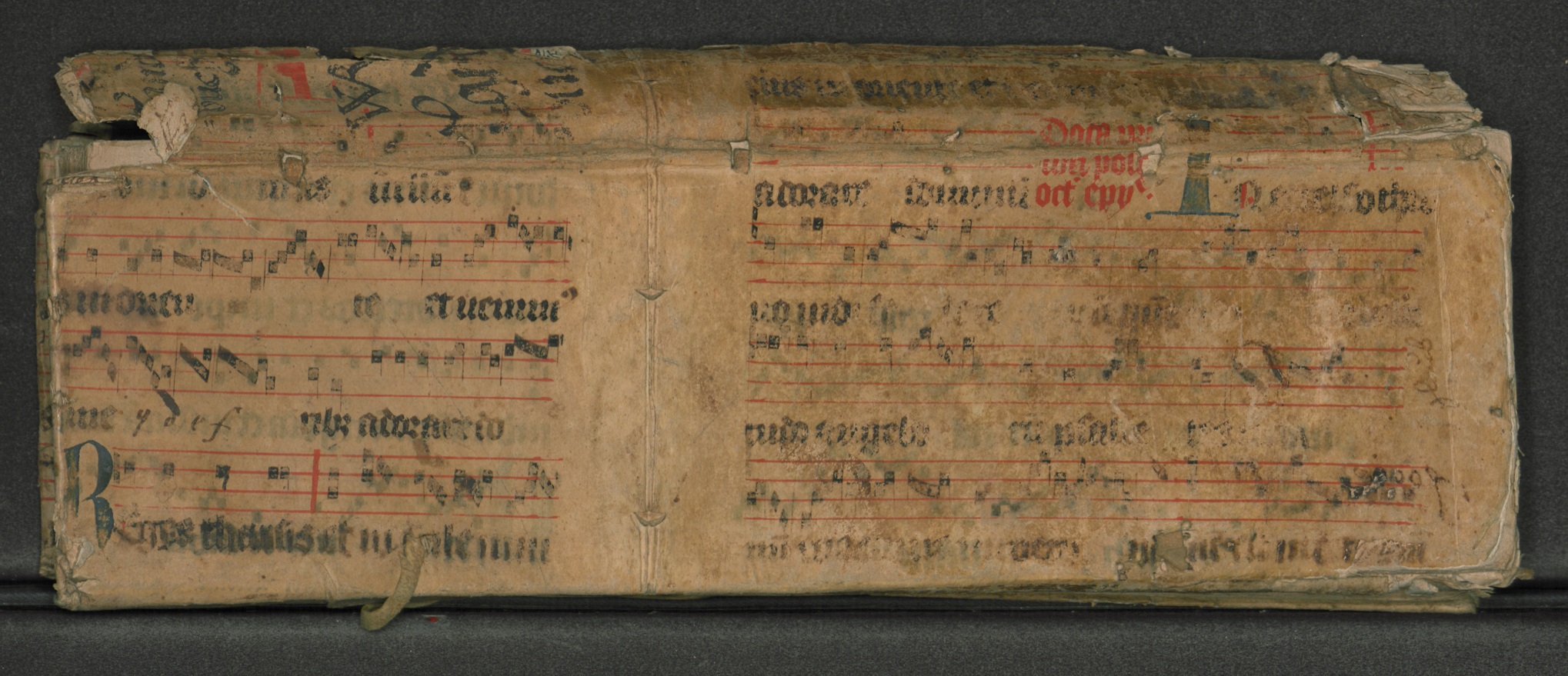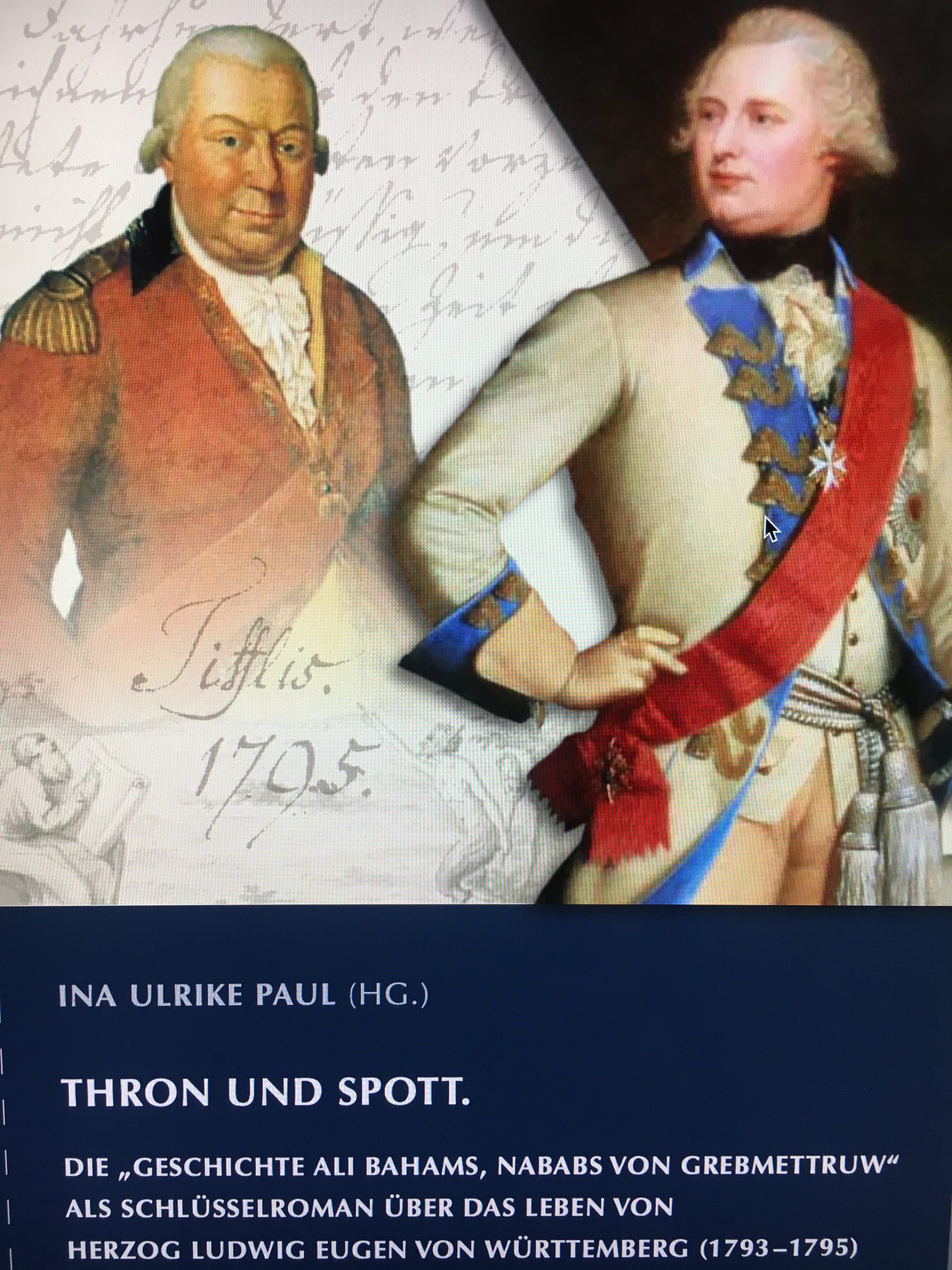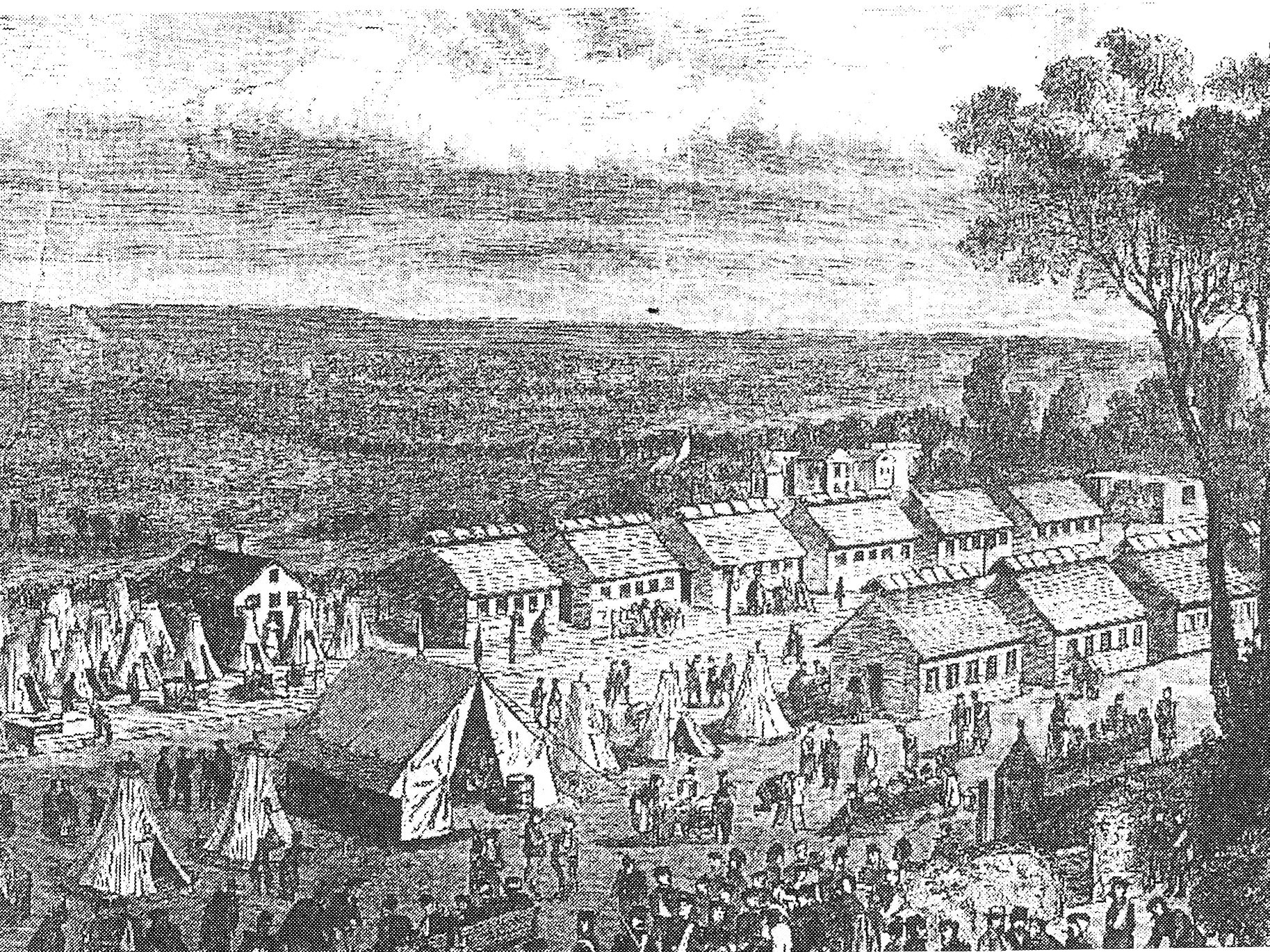Dr. Michael Hoffmann, Ellwangen: Vor 75 Jahren: Als die Bundesrepublik Deutschland im württembergischen Ellwangen entstand – der Ellwanger Kreis der CDU/CSU und das Grundgesetz 1947-1949
Hauptstaatsarchiv Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 4, Stuttgart, Baden-Württemberg, DeutschlandWarum haben die "Bundesländer" so viel Einfluss in unserem Staat, und woher stammt eigentlich die Bezeichnung "Bundesrepublik Deutschland"? Diese und andere Fragen werden in dem mit zeitgenössischen Bildern illustrierten Vortrag aufgegriffen, der sich mit der Entstehung und Bedeutung des sogenannten Ellwanger Kreises der CDU/CSU 1947–1949 beschäftigt. Dieser Freundeskreis, zu dem namhafte Politiker wie der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard, die württembergischen Minister Joseph Beyerle, Gebhard Müller und Wilhelm Simpfendörfer und der badische Minister Heinrich Köhler gehörten, entstand 1947 aus der Bemühung heraus, die verschiedenen Landesparteien der Union auf der Ebene der Besatzungszonen zu koordinieren und eine gemeinsame Verfassungsposition zu erarbeiten. In Konkurrenz mit den anderen Parteien, aber auch mit dem Adenauer-Flügel der CDU der britischen Zone, entstand aus diesem Kreis heraus ein erster stark föderalistisch ausgerichteter Verfassungsentwurf, der – wie gezeigt werden wird – großen Einfluss auf die Ausgestaltung des Grundgesetzes hatte. – Vortrag in Kooperation mit der Adenauer-Stiftung e.V., Politisches Bildungsforum Baden-Württemberg.